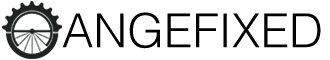Meer und Mont: Mein Fahrrad Kurzurlaub
Nach dem Besuch des Red Hook Crits in Barcelona mit den Fixedpott-Jungs und -Mädels stand eine knappe Woche „Fahrradurlaub“ nur für mich auf dem Plan. Das habe ich die beiden vergangenen Jahre schon so gemacht und wenn es nicht für eine allzu lange Zeit ist, komme ich gut ohne direkte Urlaubsbegleitung klar. In diesem Jahr wollte ich – obwohl ich nicht sicher war, ob ich es ohne richtiges Training schaffen würde – den Mont Ventoux bezwingen, den weißen Riesen der Provence.
Irgendwo kurz hinter der Spanisch-französischen Grenze verabschiedete ich mich vom Fixedpott-Bulli, der noch knapp 1.300 Kilometer bis nach Dortmund vor sich hatte und startete in meinen Solo-Urlaub mit einer Übernachtung direkt am Meer. Ein Campingplatz war schnell gefunden und nach ein bisschen Strand und Wasser ging es auf eine kurze 17-Kilometer-Tour entlang eines Fahrradweges direkt am Meer. Wäre es nicht langsam dunkel geworden, hätte ich ewig hier weiterfahren können.
Ab zum weißen Riesen der Provence
Am darauffolgenden Tag war ich früh wach und schwang mich wieder aufs Rad, dieses Mal auf eine lockere 25-Kilometer-Runde ins Landesinnere. Ich wollte ja wenigstens ein paar Kilometer abgespult haben, bevor es in die Berge ging. Mittags reiste ich dann ab und war am späten Nachmittag am Fuße des Mont Ventoux in Sault. Ich hatte mir diese Seite ausgesucht, weil dort die leichteste der drei Auffahrten auf den Berg beginnt. Zwar ist sie fünf Kilometer länger als die anderen beiden möglichen Auffahrten, dafür aber auf den ersten 20 Kilometern nicht so mörderisch steil. In Touristen-Information des Orte erzählte man mir dann aber leider, dass die Auffahrten von Sault und Bedoin beide wegen Dreharbeiten für einen Film die nächsten Tage geschlossen sein würden. Also blieb nur noch Malaucene als Startort für meine Gipfelerstürmung. Gesagt, getan: Eine Stunden später saß ich vor meinem Zelt auf einem netten Campingplatz etwas außerhalb der Stadt vor meinem Zelt und aß Nudeln. Wie man das als Profi halt so macht. Und ich trank Bier. Wie man das als Amateur halt so macht. Ich fühlte mich also gleichzeitig gut und schlecht vorbereitet.
Abends ging es noch in die Stadt, um für den kommenden Morgen ein passendes Rad auszuleihen. Ich nahm es gleich für zwei Tage, denn die Angst, es nicht direkt hoch zu schaffen oder umdrehen zu müssen und dann am zweiten Tag noch mal einen Anlauf zu haben, war schon da.
Rauf auf den Berg
Um 8.30 Uhr am nächsten Morgen stand ich beim Verleiher und nahm mein Pinarello Rennrad entgegen – Carbon statt Kondition war das Motto. Ich wollte eigentlich direkt starten, um nicht in die Mittagshitze zu geraten, kam vom Campingplatz dann aber doch erst um kurz vor zehn Uhr los. Zuerst ging es runter nach Malaucene, dann begann mit einem Schild „offiziell“ der Aufstieg. Darauf war zu lesen: 21 Kilometer bergauf, etwas über 1.500 Höhenmeter Unterschied und eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent.
Es ging ganz kurz moderat los, dann nach 2,5 Kilometern die ersten kleineren Rampen und neun Prozent Steigung. Die Randsteine bei jedem Kilometer informierten einen ziemlich genau, welche Steigung man auf den nächsten 1.000 Metern zu erwarten hatte. Das wurde ab Kilometer 4 wieder etwas moderater mit zwei bis vier Prozent, dann kamen zwei Kilometer mit über zehn Prozent und wieder ein paar entspannte Kilometer mit „nur“ drei bis fünf Prozent Steigung.
Ab Kilometer neun wurde des dann heftig: Mal neun Prozent, mal auch 12 Prozent Steigung sagte der Randstein an der Kilometermarke. Und das für knapp vier Kilometer. Irgendwo mitten in diesem Wahnsinn musste ich Pause machen, einen Schokoriegel verdrücken und ein bisschen die Beine lockern – die brannten nämlich schon ganz ordentlich, denn ich hatte jetzt schon mehr Höhenmeter hinter mir als normalerweise in zwei Wochen.
Immer wieder wurde ich überholt oder überholte selbst andere Radfahrer – ein wirkliches zusammen fahren kam leider nie zu Stande. So war man ziemlich auf sich alleine gestellt, von einem „bon jour“ beim Überholvorgang mal abgesehen. Ab Kilometer 14 wurde es dann wieder etwas „flacher“, bevor beim 15er-Marker noch mal 11 Prozent Steigung drin waren. Dann gab es einen Kilometer mit nur fünf Prozent und ab Kilometer 17 durchschnittlich acht Prozent bis zum Gipfel.
Irgendwann ging es aus dem Wald heraus (von Malaucene hat man mehr Wald und weniger freie Strecke als von Bedoin/Sault) und in die mondähnliche Steinlandschaft, die den Berg so berühmt gemacht hat. Da oben merkte ich dann, wie die Luft langsam dünner wurde und jede Pedalumdrehung weh tat. Meine Beine wollten und konnten eigentlich nicht mehr, aber es waren nur noch zwei Kilometer. Dann nur noch einer. Dann zwei Kehren noch. Dann nur noch eine kurze Rampe. Und plötzlich war ich oben.
Das „Yeah, geschafft!“-Gefühl lässt auf sich warten.
Komischerweise fühlte ich nicht direkt die Sensation, die ich erhofft hatte. Ich war erstmal für zehn Minuten nur happy, dass ich nicht mehr in die Pedale treten musste. Alles andere war mir egal. Nach einem weiteren Schokoriegel und ordentlich Wasser (was da oben 2,50 Euro für eine Miniflasche kostet) ging es dann wieder und ich konnte den Gipfel und die Aussicht genießen. Außerdem war die Filmcrew, die mir die Auffahrt über Sault vermasselt hatte, gerade dabei, eine Szene auf dem Plateau zu drehen, was ich mir natürlich gerne anguckte. Der Film – eine niederländische Produktion – heißt übrigens „Mont Ventoux“ und handelt von ein paar jungen Leuten, die Ende sich der 1980er entschließen, den Berg anzugehen.
Nach einer halben Stunde oben auf dem Berg wurde es dann irgendwann etwas kalt, denn ich hatte keine Windjacke dabei sondern nur Armlinge. Ich wollte aber kurz noch mal zum Denkmal für Tom Simpson, den englischen Rennradfahrer, der hier 1967 bei der Tour de France kollabierte und starb. Das lag allerdings auf der „falschen“ Seite, so dass ich danach wieder 200 Höhenmeter hoch musste, um auf „meine“ Seite für die Abfahrt zu kommen.
Die Abfahrt war dann krass. 21 Kilometer. Nur bergab. Mir taten vom vielen Bremsen die Arme und Hände weh und ich versuchte so oft wie möglich einfach rollen zu lassen. Allerdings führt das bei 12 Prozent Gefälle gerne mal zu Geschwindigkeiten jenseits der 70 km/h – und das war mir dann doch zu krass. Nach insgesamt vier Stunden (davon 2:08 für die Auffahrt und 0:39 für die Abfahrt) war ich wieder auf dem Campingplatz angekommen und gönnte mir eine Runde im Pool und ein Schläfchen auf der Pool-Liege.
Tag 2 mit lockerer Ausfahrt und dann doch ordentlich Höhenmetern
Da ich den zweiten Tag nun ja zur freien Verfügung hatte und meine Beine mir stark davon abrieten, noch einmal den Mont Ventoux anzugehen, erkundete ich die nähere Umgebung und fuhr eine nette 75 Kilometer-Runde, von der mein Strava leider einen ganzen Teil nicht aufzeichnete. Ich ließ es ruhig angehen und machte eine lange Mittagspause und hatte nachher trotzdem 1.300 Höhenmeter auf dem Tacho. Geht wohl nicht anders in der Gegend. Aber nach der Tortour vom Vortag war das ein relativ entspannter Ride. Am darauffolgenden Tag brach ich meine Zelt am Ventoux ab, sagte dem weißen Riesen tschüss und bis bald und fuhr die 1.100 Kilometer bis nach Hause durch – aber erst nachdem der ADAC meinem Wagen auf dem Campingplatz Starthilfe gegeben hatte.
Fazit
Fazit der paar Tage rund um das alleine Radfahren: Flach fahren hat sicherlich seinen Reiz, vor allem wenn man fixed unterwegs ist. Aber Berge fahren ist ein ganz anderes Level von Befriedigung und trotz Schmerzen in allen Teilen meines Körpers auch noch Tage nach Ventoux würde ich es gerne wieder machen – lieber heute als morgen. Die Strecke von Malaucene war im Endeffekt ein Glücksfall, denn man kann sehr lange im Schatten der Bäume fahren und muss sich erst spät durch die Mondlandschaft quälen.
Und noch eines ist mir bewusst geworden: Wenn man will, kann man selbst als halbwegs untrainierter Radler mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und ein paar Bierchen am Vorabend den Berg schaffen. Ausreichend Wasser (ich habe jede 500 Meter ein bis zwei Schlücke getrunken) und Energieriegel sollte man aber dabei haben. Und auch eine Pause kann nicht schaden. Am besten ca. auf der Hälfte, wenn es im Durchschnitt über zehn Prozent Steigung hat.